 Die kraniozervikale Instabilität (CCI) und atlantoaxiale Instabilität (AAI) sind zwei unterschiedliche Formen der Instabilität der oberen Halswirbelsäule, die beide neurologische Symptome hervorrufen können, indem sie den empfindlichen Übergang zwischen Hirnstamm und Rückenmark beeinträchtigen.
Die kraniozervikale Instabilität (CCI) und atlantoaxiale Instabilität (AAI) sind zwei unterschiedliche Formen der Instabilität der oberen Halswirbelsäule, die beide neurologische Symptome hervorrufen können, indem sie den empfindlichen Übergang zwischen Hirnstamm und Rückenmark beeinträchtigen.
Bei der kraniozervikalen Instabilität (CCI) handelt es sich um eine Instabilität an der Verbindung zwischen der Schädelbasis (C0) und dem ersten Halswirbel (C1, Atlas). Diese Instabilität führt zu einer übermäßigen Beweglichkeit oder Fehlstellung in diesem Bereich, was Druck auf den Hirnstamm und das obere Rückenmark ausüben kann. Obwohl bei CCI oft keine direkte mechanische Kompression des Rückenmarks vorliegt, führt die Instabilität dennoch zu Symptomen wie Nacken- und Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen und kognitiven Problemen. Besonders betroffen sind dabei Menschen mit genetischen Störungen wie dem Ehlers-Danlos-Syndrom oder solche, die ein Verletzung wie ein Schleudertrauma erlitten haben.
Im Gegensatz dazu betrifft die atlantoaxiale Instabilität (AAI) die Verbindung zwischen dem ersten Halswirbel (C1, Atlas) und dem zweiten Halswirbel (C2, Axis). Auch hier kann es zu einer übermäßigen Beweglichkeit oder Fehlstellung kommen, insbesondere nach Verletzungen durch beispielsweise ein Schleudertrauma oder bei Erkrankungen wie dem Down-Syndrom, dem Ehlers-Danlos-Syndrom oder der rheumatoiden Arthritis. Da das C1-C2-Gelenk für die Drehbewegung des Kopfes verantwortlich ist, führt AAI häufig zu Nackensteifheit, Kopf- und Nackenschmerzen, sowie zu Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. Wie bei einer CCI tritt eine direkte Kompression des Rückenmarks bei AAI seltener auf (außer bei Patienten mit Down-Syndrom oder rheumatoider Arthritis), obwohl es dennoch zu neurologischen Beeinträchtigungen kommen kann.
Zusammenhang mit dem zervikomedullären Syndrom
 Bei beiden Instabilitäten, CCI und AAI, tritt eher selten eine direkte mechanische Kompression des Rückenmarks auf. Dennoch verursachen sie oft schwerwiegende neurologische Symptome, die zum zervikomedullären Syndrom führen können. Dieses Syndrom entsteht nicht zwangsläufig durch eine Kompression des Rückenmarks, sondern vielmehr durch funktionelle Beeinträchtigungen im Übergangsbereich zwischen Hirnstamm und Rückenmark, die durch die Instabilität hervorgerufen werden.
Bei beiden Instabilitäten, CCI und AAI, tritt eher selten eine direkte mechanische Kompression des Rückenmarks auf. Dennoch verursachen sie oft schwerwiegende neurologische Symptome, die zum zervikomedullären Syndrom führen können. Dieses Syndrom entsteht nicht zwangsläufig durch eine Kompression des Rückenmarks, sondern vielmehr durch funktionelle Beeinträchtigungen im Übergangsbereich zwischen Hirnstamm und Rückenmark, die durch die Instabilität hervorgerufen werden.
Die CCI kann insbesondere eine Überstreckung des Hirnstamms bewirken. Diese Überstreckung entsteht durch die abnorme Beweglichkeit oder Fehlstellung zwischen der Schädelbasis (C0) und dem ersten Halswirbel (C1), auch wenn keine eindeutige mechanische Kompression des Rückenmarks vorliegt. Diese Fehlstellung oder Überbeweglichkeit kann den Hirnstamm über den sogenannten Dens axis, einen zahnförmigen Fortsatz des zweiten Halswirbels (C2), überstrecken und dadurch eine Reizung oder Funktionsstörung verursachen. Dies erklärt die Vielzahl neurologischer Symptome wie Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schwindel oder sogar autonome Störungen, die durch die Reizung der Nervenbahnen in diesem Bereich entstehen.
Bei der AAI steht hingegen die Instabilität zwischen dem ersten (C1) und zweiten Halswirbel (C2) im Vordergrund. Diese Instabilität führt weniger zu einer Überstreckung des Hirnstamms durch den Dens axis, sondern zu einer Fehlbewegung zwischen den beiden Wirbeln, die ebenfalls das obere Rückenmark oder den Hirnstamm, sowie die umliegenden Nerven, beeinflussen kann. Daher kann diese Form der Instabilität dennoch ähnliche neurologische Störungen wie bei einer CCI hervorrufen.

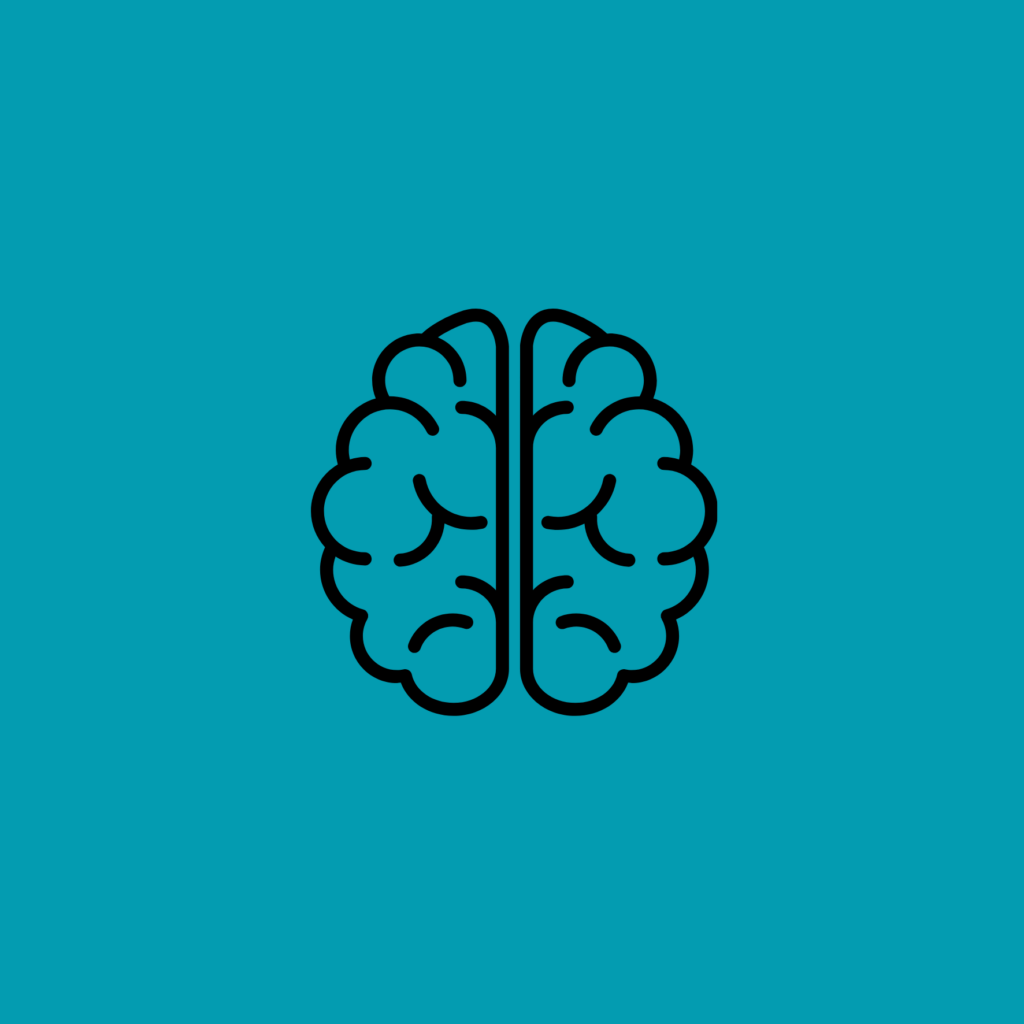



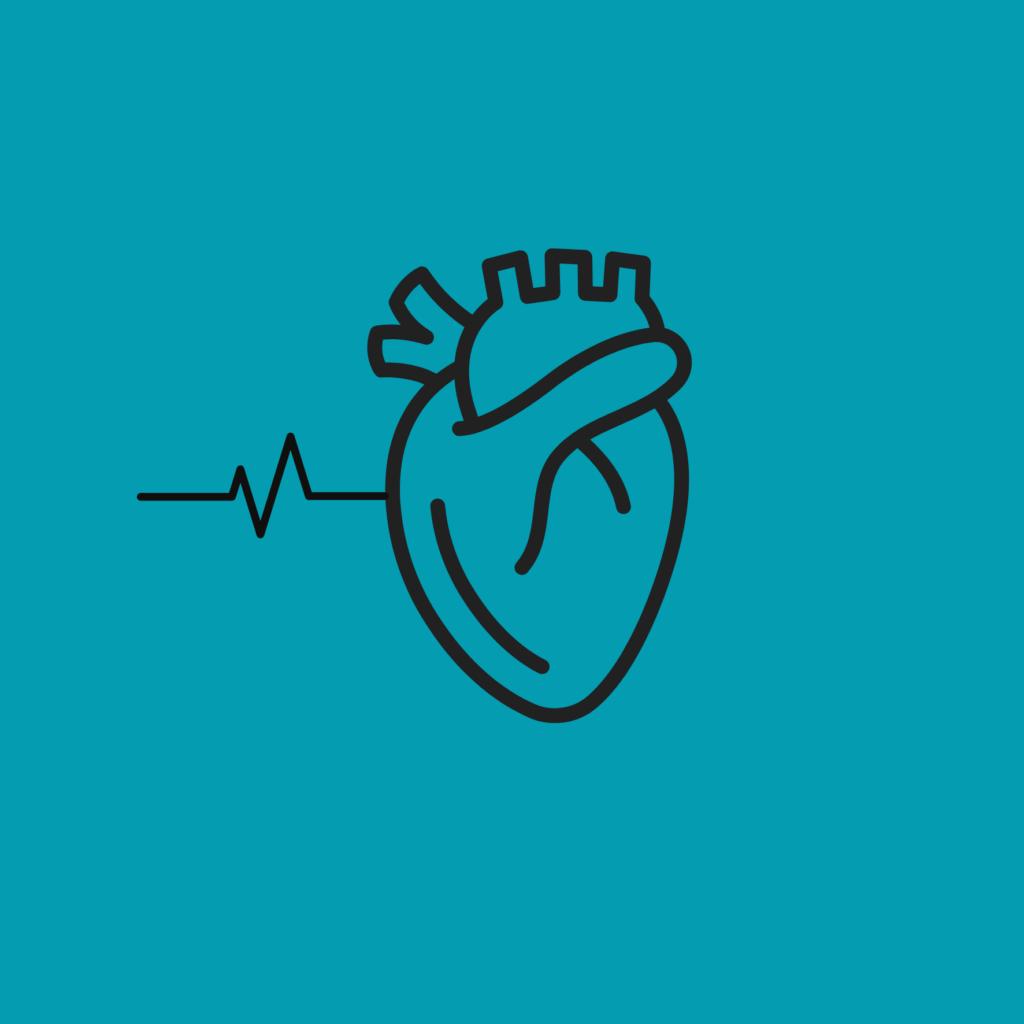
Hinweis: Die hier aufgeführten Symptome stellen keine vollständige Liste dar. Sie dienen lediglich als Zusammenfassung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Erfahrungsberichte von Betroffenen. Diese Informationen ersetzen keinen ärztlichen Rat. Bitte konsultiere bei gesundheitlichen Beschwerden eine Ärzt*in.
Das Verständnis der Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) von kraniocervikaler Instabilität (CCI) und atlantoaxialer Instabilität (AAI) ist essenziell, um eine präzise Diagnose und eine ganzheitliche Behandlung zu ermöglichen. Da sich die Symptome der Erkrankungen oft mit anderen chronischen Beschwerden wie Fibromyalgie, ME/CFS oder Migräne überschneiden, hilft die Berücksichtigung von Begleiterkrankungen, Fehldiagnosen zu vermeiden und gezielte Therapieansätze zu entwickeln. Zudem können systemische Erkrankungen wie das Ehlers-Danlos-Syndrom oder Autoimmunstörungen sowohl die Instabilitäten als auch weitere Beschwerden verstärken, die behandelt werden müssen. Auch chronische Schmerzen und psychische Belastungen wie Angststörungen oder Depressionen treten häufig als Komorbiditäten auf und erfordern spezielle Unterstützung. Die Kenntnis dieser Zusammenhänge verbessert die Prognose, ermöglicht eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit und reduziert das Risiko von sekundären Komplikationen, was letztlich die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig steigert. In diesem Kontext sollen folgende wichtige Komorbiditäten aufgeführt werden:
© COPYRIGHT – CCI/AAI Initiative e.V. – @2025