Aktueller Forschungsstand zu CCI/AAI und Komorbiditäten
Die kraniozervikale Instabilität (CCI) und die atlantoaxiale Instabilität (AAI) sind Erkrankungen, bei denen es zu einer Instabilität im Bereich der oberen Halswirbelsäule kommt, was die Funktion des zentralen Nervensystems erheblich beeinträchtigen kann. Diese Instabilitäten werden häufig mit verschiedenen anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht, insbesondere mit solchen, die auf Bindegewebsschwäche oder genetische Prädispositionen zurückzuführen sind. Allerdings können auch Menschen ohne zugrundeliegende Bindegewebsschwäche CCI oder AAI entwickeln, insbesondere aufgrund von traumatischen Ereignissen wie Unfällen oder Stürzen, die zu strukturellen Schäden an den Halswirbelgelenken und Bändern führen.

Besonders die hypermobile Form des Ehlers-Danlos-Syndroms ist eng mit CCI/AAI assoziiert. Bei diesen Personen kommt es durch die Schwäche des Bindegewebes häufiger zu Instabilitäten in der oberen Halswirbelsäule, was zu einer erhöhten Anfälligkeit für neurologische Symptome führen kann. Menschen mit EDS zeigen oft eine erhöhte Flexibilität und eine verminderte Festigkeit der Bänder, was zu einer Überdehnung der Halswirbelgelenke und einer Belastung des Nervensystems führt.
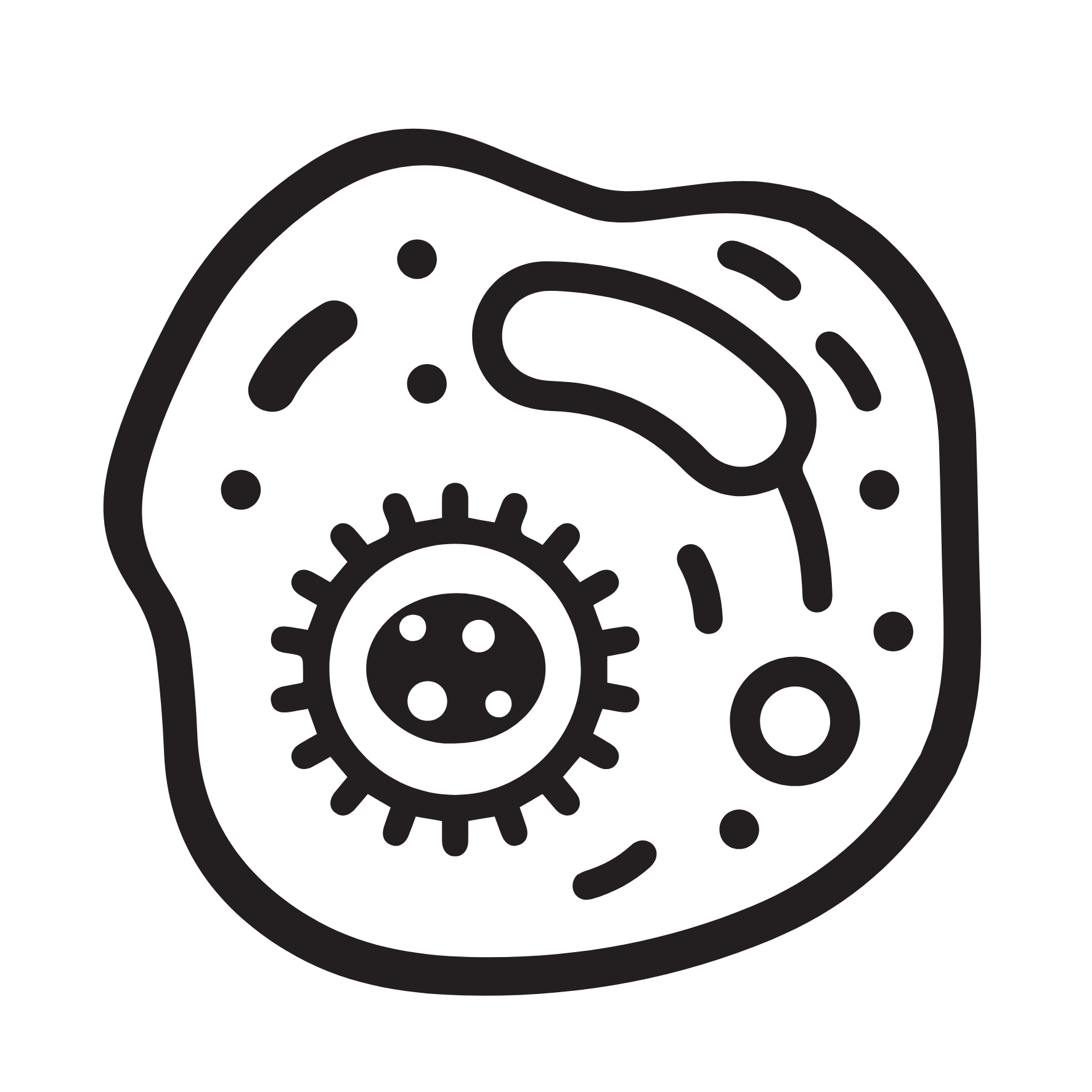
Bei Patienten mit CCI/AAI wird das Mastzellaktivierungssyndrom als häufige Begleiterkrankung untersucht. MCAS kann Entzündungsreaktionen hervorrufen, die Instabilitäten verschärfen oder durch entzündliche Schübe neue Symptome auslösen können. Dieser Zusammenhang ist noch Gegenstand aktueller Forschung und hat das Potenzial, die Behandlung von CCI/AAI zu beeinflussen.
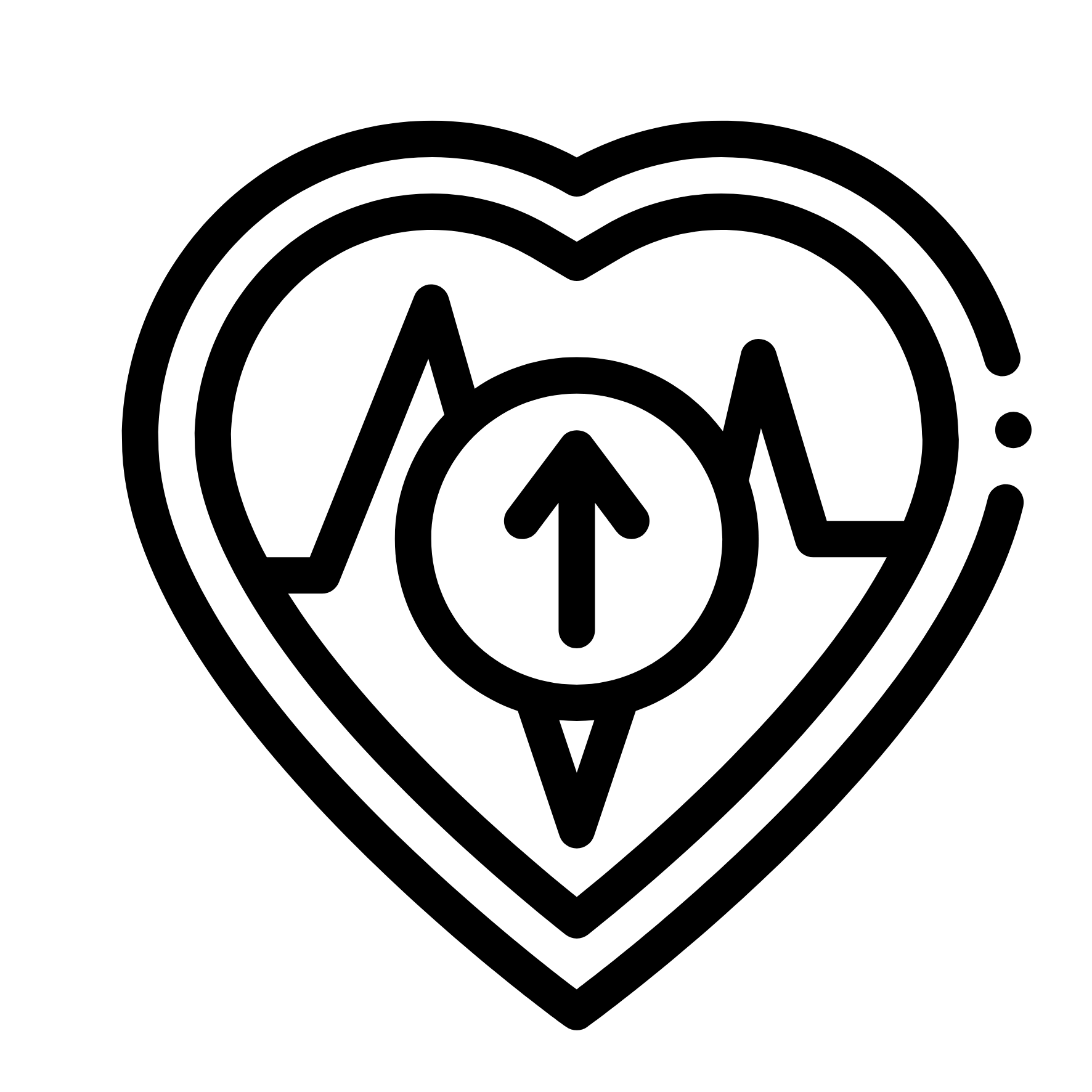
PoTS tritt oft bei Personen mit CCI/AAI auf und wird durch eine Dysfunktion des autonomen Nervensystems verursacht. Besonders bei bindegewebsbedingten Erkrankungen wie EDS kann eine mechanische Kompression des Hirnstamms und der Nervenstrukturen durch CCI/AAI die Symptome von PoTS verstärken.
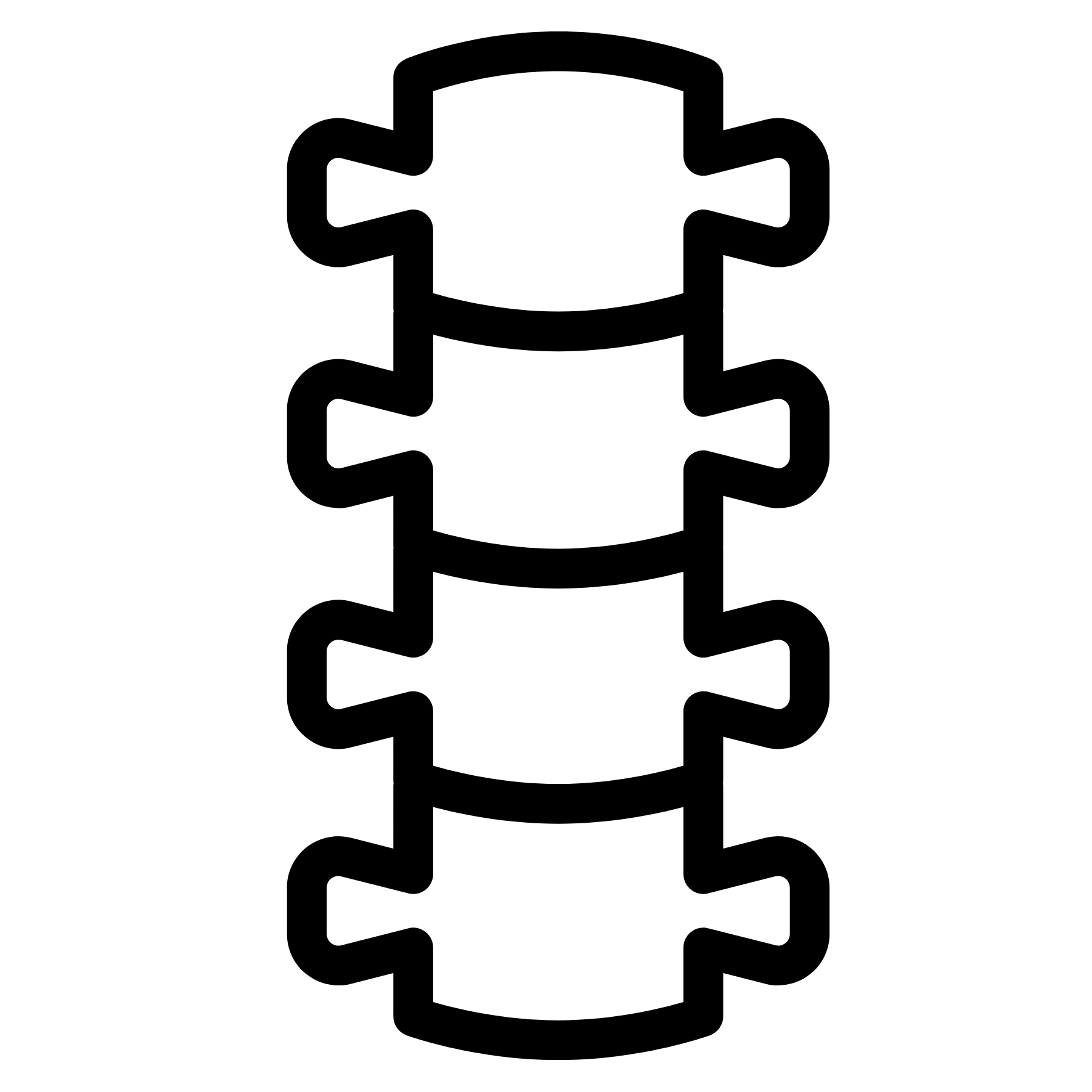
Das okkulte Tethered Cord Syndrom kann bei Betroffenen mit CCI/AAI ebenfalls auftreten. Es führt durch die Fixierung des Rückenmarks zu zusätzlicher Spannung, was die neurologischen Symptome der Instabilität verstärken kann. Diese Wechselwirkungen zwischen mechanischer Belastung und zentraler Sensibilisierung sind ein wichtiger Forschungsbereich.

Neben genetischen Faktoren können auch traumatische Ereignisse zu CCI und AAI führen. Unfälle wie Schleudertraumata (Whiplash), Stürze oder sportliche Verletzungen können dazu führen, dass die Stabilität der Halswirbelsäule beeinträchtigt wird. In solchen Fällen werden die Bänder und Gelenke der oberen Halswirbelsäule übermäßig beansprucht oder verletzt, was zu Instabilität führt. Diese traumatischen Ursachen können selbst bei Personen ohne Bindegewebsschwäche zur Entstehung von CCI und AAI beitragen und die Symptome deutlich verschlechtern. In der klinischen Praxis ist es wichtig, bei Betroffenen mit einer solchen Vorgeschichte eine gründliche Untersuchung durchzuführen, um mögliche traumatische Ursachen der Instabilität zu identifizieren.

Epstein-Barr-Virus (EBV) und andere Herpesviren:
EBV wird zunehmend mit Autoimmun- und Bindegewebserkrankungen in Verbindung gebracht. Studien zeigen, dass das Virus durch die Expression seines EBNA2-Proteins Gene beeinflusst, die für Autoimmunerkrankungen wie systemischen Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis und Multiple Sklerose prädisponieren. Dieser Mechanismus könnte die strukturelle Integrität von Bindegewebe beeinträchtigen, was auch die kraniozervikale Stabilität schwächen könnte. EBV wird außerdem durch „molekulare Mimikry“ verdächtigt, das Immunsystem dazu zu bringen, körpereigenes Gewebe anzugreifen, wie es bei der Demyelinisierung in der Multiplen Sklerose beobachtet wurde (u. a. durch Kreuzreaktivität mit GlialCAM).
Postvirale Syndrome (z. B. SARS-CoV-2):
Langzeitfolgen viraler Infektionen, wie sie bei SARS-CoV-2 beobachtet wurden, zeigen entzündliche und autoimmune Prozesse, die Bindegewebe und Muskeln angreifen können. Eine solche persistierende Immunaktivierung könnte die Bänder und Verbindungen im kraniozervikalen Bereich schwächen. Chronische Entzündungen können zudem die Regenerationsfähigkeit von Gewebe beeinträchtigen.
Mikroentzündungen:
Virale Infektionen führen oft zu Mikroentzündungen, die lange nach der akuten Phase bestehen bleiben. Diese subtile, aber dauerhafte Entzündungsreaktion kann die Stabilität der kraniozervikalen Übergangsstrukturen negativ beeinflussen, möglicherweise durch Beeinträchtigung des Kollagenstoffwechsels und der ligamentären Elastizität.
Die Erkenntnisse legen nahe, dass virale Infektionen durch direkte Schädigung, immunologische Fehlregulation und chronische Entzündungsprozesse eine Rolle bei der Entwicklung von CCI spielen könnten.
 Die Forschung zu CCI/AAI und den dazugehörigen Komorbiditäten hat in den letzten Jahren zugenommen, befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Besonders interessant ist die Untersuchung von traumatischen Ursachen für CCI/AAI und deren langfristige Auswirkungen auf die Betroffenen. Zukünftige Studien werden sich auf die Identifizierung genetischer Prädispositionen sowie auf die Entwicklung besserer Diagnose- und Behandlungsmethoden konzentrieren
Die Forschung zu CCI/AAI und den dazugehörigen Komorbiditäten hat in den letzten Jahren zugenommen, befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Besonders interessant ist die Untersuchung von traumatischen Ursachen für CCI/AAI und deren langfristige Auswirkungen auf die Betroffenen. Zukünftige Studien werden sich auf die Identifizierung genetischer Prädispositionen sowie auf die Entwicklung besserer Diagnose- und Behandlungsmethoden konzentrieren
 Während ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelites / Chronic Fatigue Syndrome) lange Zeit als eigenständige Erkrankung ohne offensichtliche strukturelle Ursachen betrachtet wurde, haben einige Forscher begonnen, mögliche anatomische oder mechanische Auslöser in Betracht zu ziehen, die bei der Entstehung oder Verschlimmerung der Symptome eine Rolle spielen könnten. Eine dieser Hypothesen ist, dass das CCI/AAI und OTC durch die anhaltende Spannung des Rückenmarks (‚stretch injury‘) zu einer chronischen Aktivierung des Nervensystems führt, was eine Vielzahl von Symptomen wie Schmerzen, neurologische Beeinträchtigungen und chronische Erschöpfung hervorrufen kann – Symptome, die auch für ME/CFS charakteristisch sind. Insbesondere neurologische Symptome wie kognitive Beeinträchtigungen, Erschöpfung und autonome Dysfunktionen könnten auf diese mechanische Belastung zurückzuführen sein. In einer Fallstudie wird auch die Remission der ME/CFS-Symptomatik nach der chirurgischen Behandlung einer Spinalkanalstenose in drei Fällen diskutiert.
Während ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelites / Chronic Fatigue Syndrome) lange Zeit als eigenständige Erkrankung ohne offensichtliche strukturelle Ursachen betrachtet wurde, haben einige Forscher begonnen, mögliche anatomische oder mechanische Auslöser in Betracht zu ziehen, die bei der Entstehung oder Verschlimmerung der Symptome eine Rolle spielen könnten. Eine dieser Hypothesen ist, dass das CCI/AAI und OTC durch die anhaltende Spannung des Rückenmarks (‚stretch injury‘) zu einer chronischen Aktivierung des Nervensystems führt, was eine Vielzahl von Symptomen wie Schmerzen, neurologische Beeinträchtigungen und chronische Erschöpfung hervorrufen kann – Symptome, die auch für ME/CFS charakteristisch sind. Insbesondere neurologische Symptome wie kognitive Beeinträchtigungen, Erschöpfung und autonome Dysfunktionen könnten auf diese mechanische Belastung zurückzuführen sein. In einer Fallstudie wird auch die Remission der ME/CFS-Symptomatik nach der chirurgischen Behandlung einer Spinalkanalstenose in drei Fällen diskutiert.
Der Forschungsstand zu den Verbindungen zwischen CCI/AAI/OTC und ME/CFS ist noch in einem frühen Stadium. Bisher gibt es nur vereinzelte Studien und Fallberichte, die auf eine mögliche Beziehung hindeuten. Einige Patienten mit ME/CFS, die nachweislich eine CCI/AAI und/oder ein OTC hatten und sich einer chirurgischen Entlastung des Rückenmarks unterzogen haben, berichteten über eine Verbesserung ihrer Symptome. Diese Beobachtungen sind jedoch noch nicht systematisch genug untersucht worden, um allgemeingültige Aussagen treffen zu können.
Es ist weiterhin unklar, wie häufig CCI/AAI/OTC bei Menschen mit ME/CFS auftritt oder inwieweit es eine ursächliche Rolle bei der Entstehung der Erkrankung spielt. Ebenso fehlen Langzeitstudien, die den Nutzen chirurgischer Eingriffe bei ME/CFS-Patienten mit CCI/AAI/OTC eindeutig belegen könnten. Dennoch wächst das Interesse an diesem Forschungsgebiet, da es möglicherweise neue therapeutische Ansätze für eine bislang schwer behandelbare Erkrankung wie ME/CFS eröffnen könnte.
© COPYRIGHT – CCI/AAI Initiative e.V. – @2025